Lernprogramme überschwemmen
den Markt und sind auch kostenlos im Internet zu finden. Sie entsprechen
einer weit verbreiteten Alltagstheorie vom Lernen.
Aber entscheiden Sie selbst,
was Lernprogramme leisten können?
|
|
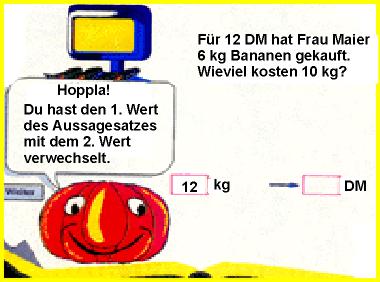
|
| |
|
|
|
Hier ein "Muster"
für den Ablauf einer möglichen Interaktion in einem Lernprogramm
|
|
Nach Einschalten des Rechners
erscheint nach einigen Tasten-Drucken die erste Übung auf dem Bildschirm.
Etwa: "27 + 48 = ....".
An Stelle der Pünktchen blinkt der Cursor solange, bis eine Zahl eingetragen
wird.
Schreibt man 75 ein, so gibt der "Computer" eine Belobigung etwa in Form
von Text, Bild oder Ton und eine neue Aufgabe. ....
Schreibt man aber 65 ein, so gibt der "Computer" (hoffentlich!) eine zielgerichtete
Hilfe zum "Zehner" und erlaubt erneut zu antworten.
Ist die eingetragene Zahl nun richtig, so siehe vorher. Ist sie wieder falsch,
so gibt der "Computer" in der Regel die richtige Antwort und eine neue Aufgabe.
Und das Ganze ist heute mit viel schrillen Tönen, bunten Bildern und
Trallala-Geschichten verbunden. |
| |
|
|
|
Können
Übe- und Lernprogramme gut sein?
|
| |
|
|
|
Keine Frage:
Üben ist notwendig
Übe-Beispiel:
Rechensätze
Ableitung von
"Wurzel aus x"
|
|
Aber: Was geschieht eigentlich beim Üben? Vor einem Anwortversuch
soll der Problemgehalt der Frage noch etwas weiter verdeutlicht werden.
Nehmen wir als erstes Übe-Beispiel das der Rechensätze. Niemand
wird bestreiten, dass Sätze wie "sieben und acht ist fünfzehn"
oder fünf mal fünf ist fünfundzwanzig" sozusagen wie im
Schlaf gekonnt sein sollten. Hierzu eine erste Testfrage an alle Menschen,
die älter als 8 Jahre und keine Grundschullehrerin sind. Was ist
sieben mal neun? Die meisten Menschen antworten nicht unmittelbar und
spontan. Sie reproduzieren im "Reden mit sich selbst" wie folgt oder ähnlich:
sieben mal neun ..äh.. neun mal sieben ..äh.. zehn mal sieben
..äh.. siebzig minus sieben; ach ja: dreiundsechszig! Nun aber auch
noch eine Testfrage an alle Grundschullehrerinnen. Was ist die Ableitung
von "Wurzel aus x"? Ohne Zweifel müssten die Ableitungen mindestens
reproduzierbar da sein, denn sie sind mindestens ein Jahr lang vor dem
Abitur eingeübt worden!
Nehmen wir als zweites Beispiel das Üben von nicht-kognitiven Sachverhalten,
nämlich das Autofahren. Nicht-kognitiv bedeutet hier nicht, dass
das Großhirn nicht beteiligt ist, wohl aber in anderer Weise als
bei den Rechensätzen. Und hier wieder zwei Fragen: Warum verlernen
wir beim Autofahren nicht zu bremsen, wenn Rot vor uns aufleuchtet? Erstens
weil wir es tagtäglich tun. Wir bleiben in Übung, genau wie
es die Grundschullehrerinnen sind, die fast täglich sagen müssen:
"Sieben mal neun ist dreiundsechzig." Zweitens aber weil grundlegende
Bewegungsabläufe wesentlich im Kleinhirn "verankert" sind.
Beim Behalten von geübten Sachverhalten spielt also die Regelmäßigkeit
des Tuns und der Speicher-Ort eine Rolle. Es sollte schon jetzt klar sein,
dass Rechensätze nicht "wie im Schlaf" oder "wie das Autofahren"
gekonnt sein können.
|
| |
|
|
|
Geübte
kognitive Sachverhalte hinterlassen im Großhirn ihre "Spuren"
|
|
Kognitive Sach- und Sinnverhalte aktivieren und hinterlassen nach ihrer
(mehrfachen) Wahr-Nehmung im Großhirn eine "breite Spur"! In Positronen-Emissions-Tomographien
(PET) lässt sich zeigen, dass im Großhirn beim Hören eines
Wortes große und teilweise nicht zusammenhängende Bereiche,
beim Sprechen eines Wortes andere aber wiederum große und teilweise
nicht zusammenhängende Bereiche und beim Ausdenken eines Wortes wieder
andere aber wiederum große und teilweise nicht zusammenhängende
Bereiche aktiviert werden.

Beim gleichzeitigen bewussten Hören, Sprechen und Ausdenken (Interpretieren)
überlappen sich aber die aktivierten Bereiche gegenseitig und werden
dadurch zusammenhängend. Spuren von Zusammenhängen bleiben dabei
erhalten, die später ein ein Reproduzieren erleichtern. Ergänzend
wird auf weitere Erkenntnisse aus der Hirnforschung
verwiesen.
Die bisherigen Überlegungen erlauben nun, aufgeklärter zu fragen:
Wie lässt sich erreichen, dass durch Üben die bereits gelernten
kognitiven Sach- und Sinnverhalte längerfristig und (nachhaltig)
behalten werden?
Üben ist zunächst nicht anderes als ein wiederholtes Lernen.
Beides, Üben wie Lernen, sind konstruktive Lernprozesse. Üben
als wiederholtes Lernen, sollte also in immer wieder anderen Zusammenhängen
stattfinden. Das Lernparadigma ist nicht aufteilbar nach Lernen und Üben.
|
| |
|
|
| Lernprogramme
fördern ein isoliertes Üben in kleinen Schritten
|
|
Lernprogramme bieten einen multimedial aufbereiteten, programmierten
Unterricht auf der Basis von operationalisierten Feinlernzielen in einer
teacher-proof-Umgebung.
Der "programmierte Unterricht" ist eine überholte Theorie. Alle in
den 60er Jahren angebotenen Lernprogramme in Buchform sind Ende der 70er
Jahre wieder vom Markt verschwunden. Heute leben sie "multimedial"
neu auf.
|
| |
|
|
| Und
doch gibt es Erfolgsmeldungen zum Üben mit Programmen
|
|
Sicher kann man zunächst sagen, Lernprogramme schaden nicht. So
wie auch der programmierte Unterricht oder die Sprachlabore nicht geschadet
haben. Aber die Antwort ist nicht zufrieden stellend. Daher sollen nun
drei Typen von Erfolgsmeldungen kurz diskutiert werden.
"Es macht Spaß", ist eine viel geäußerte Erfolgsmeldung.
Aber der Spaß bezieht sich auf das neuartige Gerät und
nicht unbedingt auf die Inhalte des Lernprogramms. Wird entdeckt, dass
es doch wieder die alte kleinschrittige, isolierte Paukerei ist, ebbt
der Spaß erheblich ab. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Sie wurde
bereits in den 70er Jahren mit dem programmierten Unterricht gewonnen.
Wird unmittelbar nach dem Durcharbeiten eines Lernprogramms genau das
getestet, was im Programm lernbar war, dann ist dieser Test in der Regel
sehr erfolgreich.
Aber ein Wiederholungstest nach einiger Zeit zeigt, dass dieses
Wissen schnell verderblich ist.
"Das Programm schimpft und straft nicht und bleibt geduldig." Hinter dieser
Aussage verbergen sich negative Lernerfahrungen. Etwa die: "meine Mutter
schreit immer sofort, wenn ich etwas nicht kann." Also im Einzelfalle
können Lernende mit Lernprogrammen wieder Zutrauen zur eigenen Leistungsfähigkeit
finden, wenn die aufgebaute Lernblockade "Mensch" fortgenommen wird.
|
| |
|
|
|
Isoliertes
Üben führt nicht zu stabilen Behaltensleistungen
|
|
'Sieben mal neun gleich dreiundsechzig', 'sieben mal neun gleich dreiundsechzig',
..., aktiviert je nach Akzentuierung des Lernenden nur einen ausgesprochen
kleinen Bereich im Großhirn, manchmal nur den des mit sich selbst
Sprechens. Üben in der Form von kleinen und isolierten Häppchen
aktiviert im Gehirn in der Regel voneinander isolierte Bereiche. So lässt
sich verstehen, dass diese Übe-Methode keinen dauerhaften Erfolg
hat, dass sie aber auch nicht schadet und manchmal sogar kurzfristig hilft.
"Einhämmern", Pauken und Bimsen sind ein Üben von
isolierten Ausdrücken, Vokabeln, Fakten und Aussagen ohne jeglichen
Sinn- und Sachzusammenhang. Dass aber in Zusammenhängen länger
behalten wird, ist so unbekannt nicht. Denn immer schon gab es sogenannte
Eselsbrücken, wie: "333 bei Issus Keilerei", "wer nämlich mit
h schreibt ist dämlich" oder "URI (für UxR=I)" oder Mnemotechniken
für das Behalten von Geschichten.
Erinnern wir uns hierzu auch an die obige Reorganisation von "sieben mal
neun ist dreiundsechsig". Das Ergebnis wurde in der Gesamtstruktur des
Einmaleins (hier: Tauschregel und Nachbaraufgabe ...), also in einer Metastruktur
erinnert. Solche Strukturen aktivieren im Großhirn viele Bereiche.
Gibt es unter den aktivierten Bereichen bereits Verbindungen oder können
sie aktuell aufgebaut werden, weil es so geübt worden ist, so kann
das Ergebnis ohne Nachschlaghilfe rekonstruiert werden, wenn es nicht
bereits unmittelbar verfügbar war.
Das Ergebnis der bisherigen Überlegungen lautet also: Soll Gelerntes
längerfristig reproduzierbar sein, so muss es in Sinn- und Sachzusammenhänge
einbettet geübt werden. Und zwar muss es immer wieder sowie in anderen
Sachzusammenhängen geübt werden. Dann gibt es eine berechtigte
Hoffnung, dass auch noch nach längerer Zeit die im Großhirn
aktivierten Bereiche zusammenhängend sind oder gemacht werden können
und dann auch das Geübte rekonstruiert werden kann. Solche Zusammenhänge
können für die einen in logischen für die anderen in situativen
und wieder für andere in anwendungsbezogenen Sach- und Sinverhalten
stecken. Die Denkschrift: "Bildung der Zukunft - Zukunft der Schule" spricht
vom "intelligenten Wissen".
|
| |
|
|
| Beispielhaft
sind Übe-Medien dann, wenn sie als Lernumgebung gestaltet sind
|
|
Grundsätzlich müssen Lernumgebungen (learning environments)
für individuelles Üben so gestaltet sein, dass
- die Aktionen immer vom Lernenden ausgehen und dafür auch Selbstverantwortung
übernommen werden kann (also selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt),
- ein wiederholtes Lernen (derselben Sache) immer wieder in anderen
komplexen Sinn- und Sachzusammenhängen ermöglich wird (also
eigenaktiv konstruktiv und nicht instruktiv isoliert und in kleine Häppchen
zerlegt) und
- ein "Sprechen mit sich selbst" angeregt und gefördert wird (also
kommunikativ und nicht bimsend).
Dann besteht die Hoffnung, dass mit Unterstützung dieser Medien
das Üben zu einem längerfristigen Behalten führt und das
Geübte produktiv werden kann. Aber auch solche beispielhaften Lermedien
bewirken nichts von selbst, auch sie sind keine Nürnberger Trichter.
|
| |
|
|
| "Üben
in kleinen Schritten" ist eine ungünstige, aber weit verbreitete Alltagstheorie
|
|
Die Lernmethode des kleinschrittigen Lernens und Übens ist weit
verbreitet. Viele Menschen haben verinnerlicht, dass man so lernt. Wen
wundert es also, dass heutige Programmiererinnen und Programmierer genau
diese Methode in "neuen" Lernprogrammen abbilden? Wen wundert es, dass
die meisten Eltern mit dem Wort "üben" kleinschrittiges Drillen assoziieren?
Wen wundert es, dass es Lehrerinnen und Lehrern schwer fällt, sich
auf eine andere Form des Lernens und Übens einzustellen? Wen wundert
es also schließlich, dass Programme, die nach dem Strickmuster des
Programmierten Unterrichts konstruiert worden sind, auch gekauft werden?
Jede Alltagstheorie enthält aber auch einen Kern von Wahrheit. "Üben
in kleinen Schritten" meint auch, dass auf bereits Bekanntes aufzubauen
ist und man Lernende dort abholen sollte, wo sie stehen. Genau diese Vorstellungen
bleiben auch in neueren Lerntheorien gültig.
Verwiesen sei auch auf Erfahrungen aus der Kognitionsspychologie,
wonach die Einschaltung mehrerer Sinneskanäle beim Lernen und Üben
bedeutungsvoll ist.
|
| |
|
|
|
|
|
|
© Pädagogisches
Institut der deutschen Sprachgruppe - Bozen - 2000
|

